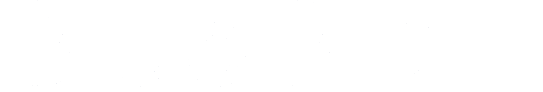Main page
»
Bücher
»
Drucke des 18. Jhd.
»
Vertheidigung der Rechtlichen Staatsbetrachtungen über die Frage: Ob die in dem Fürstlich Hessischen Gebiete gelegenen Güter und Einkünfte der von dem Kurfürsten zu Mainz im Jahre 1781 aufgehobenen drei Klöster dem Kurfürsten von Mainz, oder den Landgrafe

gebraucht; gut - Umschlag etwas berieben u. geknickt, kleine Fehlstelle am oberen Buchrücken, Buchblock leicht wellig. - Prolog: 2006 feierte die Stiftung Mainzer Universitätsfond ihr 225 jähriges Bestehen, mit einer Festschrift. An deren Anfang ein Rückblick. Erstens: die Geschichte eines unterfinanzierten Lehrbetriebs (1774 - 1777); zweitens: das dreihundertjährige Jubiläum und ein Sanierungskonzept (1777), drittens: die Umwandlung von Klosterbesitz in Stiftungskapital - Gründung des Mainzer Universitätsfonds (1881). [1] Initiator der Sanierung ist der Mainzer Erzbischof Friedrich Karl Joseph von Erthal – protokollarisch der zweite Mann im römischen Reich deutscher Nation. Christian August von Beck (1720-1784) beschreibt seine Stellung: der Mainzer Herr ist des „Heiligen Römischen Reichs Erzkanzler durch Germanien ... und sowohl in dem geistlichen als weltlichen Staat von Deutschland nach dem Kaiser die erste Person“. [2] Als ehemaliger Rektor der Universität kennt Erthal die finanzielle Misere: ihm ist „es von der Vorsicht vorbehalten, diesem Uebel mit Bestande zu steuren …" (Er) bemerkt, daß es an den wesentlichen Mitteln gebräche, gute Köpfe zu ermuntern, Verdienste zu belohnen, den Fleiß zu beleben, Aufklärung zu verbreiten, die Wissenschaften in Flor und Aufnahme zu bringen.“ [3] Aus den erzbischöflichen Einnahmen ist dieses Projekt nicht finanzierbar: es bedarf der Aufhebung von drei Klöstern, deren Besitz in eine Universitätsstiftung überführt wird. Und dies ist dann der erste von fünf Akten eines langjährigen und vielbeachteten Rechtsstreites. Zweiter Akt: die aufgehobenen Klöster haben ansehnlichen Besitz auf hessischem Boden. Von den dortigen Territorialherren kommt nun postwendend ein Schreiben (28.05.1782). Die Fürstlich-Hessische Regierung zu Darmstadt teilt der Kürfürstlichen Mainzischen Regierung mit, dass sie mit ihrer Universitätsfinanzierung gegen Artikel 5, § 47 des westfälischen Friedens verstoße. Dort sei geregelt, „daß mit der Aufhebung und Erlöschung einer moralischen Person oder Körpers, dergleichen die … Klöster gewesen, sofort auch dessen Privateigenthum erlöschet und herrenlos wird.“[4] Ein anonymer Kenner des Verfassungsrechts liefert dem Fürstbischof Gegenargumente. Er ist überzeugt, dass es hier um eine Frage geht, die „für alle deutsche(n) Bürger, denen es ohne Rücksicht der Religion an einer wechselseitigen Gerechtigkeit gelegen ist“, höchst wichtig ist: „Eine Frage, welche in Zukunft bey dem so thätigen Klosteraufhebungs Geiste für alle und jede deutsche Reichstände insonderheit und eigends wichtig werden kann!“ [5] Und da droht bei hessischer Auslegung der westfälischen Friedensverträge Gefahr für katholischen Streubesitz. [6] Unser Anonymus macht folgerichtig den Streit um die hessische 'Arrestierung' der strittigen „Güter und Gefälle“ zum konfessionellen Konflikt. Die „Fürstlich Hessische Regierung“ missachtete das Gleichheitsgebot des westfälischen 'Reichsgrundgesetzes'. Hier lege der Artikel 5, § 47 fest:„So wie die Güter und Gefälle eines … eingehenden Klosters, welches in einem protestantischen Reichslande liegt, und einem protestantischen Reichsstande zugehört, dem protestantischen Landesherrn von Reichsrechtswegen zuständig sind, wenn die zu einem solchen Kloster gehörigen Güter und Gefälle gleichwohl in katholischen Landen liegen: eben so sind die Güter und Gefälle eines … eingehenden Klosters, welches in einem katholischen Reichslande liegt und einem katholischen Reichsstande zugehört, dem katholischen Landesherren von Reichtsrechtswegen zuständig, wenn die Güter und Gefälle eines solchen Klosters gleichwohl in protestantischen Landen gelegen sind.“ [7] Der dritte Akt: Auftritte vieler protestantischer Experten in Sachen Recht. Auf den Anonymus antwortet zunächst der Gießener Rechtsprofessor Johann Christoph Koch [8], ein zweiter Gießener legt nach [9]: der anonym geforderte Gleichheitsgrundsatz gehe an der geschichtlichen Bedeutung der westfälischen Reichsgesetzgebung vorbei. Im Artikel 5 haben – so die beiden Gießener – die Protestanten das Recht ihrer Landesherren auf territoriale Hoheit durchgesetzt: nachdem „die Katholische den Evangelischen die aus katholischen Landen begehrte Einkünfte der geistlichen Fundationen … versagt“ hatten, setzten die im Westfälischen Friedensvertrag die Regelung durch, dass die Klöster und Stiftungen „die mit dem Jahre 1624 erloschen sind oder künftig erlöschen werden, auch in anderen Gebieten dem Herrn des aufgelösten Klosters oder Ortes, in dem dieses gelegen waren, entrichtet werden.“ [10] Und noch ein Gießener meldet sich: der Nationalökonom Johann August Schlettwein. Sein Hinweis - der westfälische Friedensvertrag rechnete nicht mit dem Fall einer Aufhebung von Klöstern aus „poltischen Absichten“: es ist „keine Sylbe davon zu finden, daß die Katholiken sich das Recht einer politischen Klosteraufhebung zugeschrieben hätten, oder von dem Rechte etwas gesagt hätten, im Falle einer künftigen Klosteraufhebung, den Ordensleuten alle ihre, auch fremde Güter zu entziehen, und auschließend vor dem Landesregenten, in dessen Gebiete diese liegen, sich zuzueignen“ [11] Die katholischen Experten sammeln sich zur Gegenrede: vierter Akt. Ein wirklicher geheimer Rat aus Baden versucht mit großem Aufwand den Nachweis, dass der Untergang von Klöstern und Stiftungen kein „die Dismembration ihrer Gefälle rechtfertigende Veränderung der Umstände sey.“ [12] Und hier kommt nun auch der erneute Auftritt unseres Anonymus. Der war inzwischen längst enttarnt: Johann Richard von Roth, ordentlicher Professor an der Universität, die durch das Projekt Klosteraufhebung grundfinanziert werden sollte. Sein zweiter Beitrag ist unser Buch: die 'Vertheidigung der Rechtlichen Staatsbetrachtungen'. Im Vorwort ist er zunächst einmal zornig: auf seinen Giessener 'Revidenten' Koch, der „ihm niederträchtige Absichten zu(dichtet)“ und „in Eile einige Scheingründe mit Schmähungen vermischt auf(wirft)“. Grundsätzlich hält er daran fest:„Der Kurfürst und Erzbischof von Mainz hat vermöge der ihm nach dem natürlichen und positiven, göttlichen und menschlichen, geistlichen und weltlichen Rechte unstrittig zustehender Befugniß auf eine Reichs- und Kirchenverfassungsgemäsige Weise unter den beiden höchsten Reichs- und Kirchenoberhauptes vollkommner Bestätigung die besagten drei Klöster in seinem Stiftslande aufgehoben, und dieselben in der Absicht der grösseren Beförderung des Staates und Kirchenwohlfahrt einer anderen geistlichen Stiftung der hohen Schule zu Mainz übertragen und einverleibet.“ [13] Der fünfte Akt ist Ereignisgeschichte: nach einigen Briefwechseln reagiert der Mainzer Kurfürst. Er schlägt „nach erschöpftem gütlichen Versuche den reichsgesetzmäßigen Rechtweg ein“ und stellt seine Ansprüche „wider die beyyden Herren Landgrafen seiner Kaiserlichen Majestät bey dem Kaiserlichen Reichshofrath vor“. Er wünscht von ihm eine „hochrichterliche Entscheidung“, „ob die in dem Fürstlich Hessischen Gebiete der von dem Kurfürsten von Mainz im verflossenen Jahre aufgehobenen drey Klöster dem Kurfürsten von Mainz, oder dem Fürstlich Hessischen Hause von Reichsrechtwegen zugefallen sind.“[14] Der Fürstbischof und seine Universität erreichen ein 'Kaiserliches Mandat', „wodurch die hohe Schule in dem rechtmäßig ergriffenen Besitze geschützet“ wird. Die beiden hessischen Landgrafen zeigen sich unbeeindruckt: Fristen verstreichen, Strafandrohungen bleiben wirkungslos. Stattdessen nehmen die Landgrafen „Rekurs an den Reichstag“. Und dort ist die Sache anhängig, als im Jahr 1798 die 'französische Gewalt' die Kurfürstliche Universität zu Mainz aufhob, „indessen die Herren Landgrafen … in dem Genusse des gedachten Kurfürstlichen Universitäts-Vermögens“ bleiben.“ [15] Epilog: 2006, Jubiläum, Festschrift. Und ein Rückblick: „Die Stiftung hat im Laufe ihres Bestehens durch politische und gesellschaftliche Umbrüche eine wechselvolle Geschichte erlebt. Das einschneidendste Ereignis war sicherlich der Verlust des rechtsrheinischen Grundbesitzes und damit fast der Hälfte des Stiftungsvermögens“. Dennoch ist was hängengeblieben: „Das Stiftungsvermögen umfasst 131 Wohnungen und 11 Einfamilienhäuser sowie ca. 400 Erbbaurechtsgrundstücke in bester Stadtlage von Mainz und in Rheinhessen. Ferner gehören der Stiftung ca. 850 ha landwirtschaftliche Flächen (Weinberge, Ackerland), von denen ein Teil der Weinberge in Spitzenlagen Rheinhessens zu finden ist. Damit gehört die Stiftung Mainzer Universitätsfonds zu den bedeutendsten Großgrundbesitzern in Rheinland-Pfalz.“ [16] [1] Stiftung Mainzer Universitätsfond (Hg.), 225 Jahre Stiftung Mainzer Universitätsfond; Mainz 2006, S. 15ff.[2] zit. nach: Hermann Conrad (Hg.), Recht und Verfassung in der Zeit Maria Theresias, Köln Opladen 1964 (= Wiss. Abhandlungen der Arbeitsgem. für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 28), S. 484)[3] Erzbischöfflich-Mainzische Verordnung, die Errichtung der 17 Professors-Präbenden bei der der Mainzer hohen Schule betreffend; Abdruck in: Mainzer Monatsschrift von geistlichen Sachen, 1. Band, 1. Heft (den 15ten November 1784), Mainz 1784, S. 12f.[4] Beilage: Copie von dem Schreiben, in: Anonym, Rechtliche Betrachtungen über die Frage: ob die in dem Fürstlich Hessischen Gebiete gelegenen Güter und Einkünfte der von dem Kurfürsten zu Mainz im verflossenen Jahre 1781 aufgehobenen drei Klöster dem Kurfürsten von Mainz, oder den Landgrafen von Hessen von Reichtsrechtswegen zugefallen sind? Verfasset zur Erläuterung des fünften Artikels des Westphälischen Friedens; Offenbach am Main 1783, S. 156f.[5] Anonym, Rechtliche Staatsbetrachtungen über die Frage: ob die in dem Fürstlich Heßischen Gebiete gelegenen Güter und Einkünfte der von dem Kurfürsten zu Mainz im verflossenen Jahre 1781. aufgehobenen drei Klöster dem Kurfürsten von Mainz, oder den Landgrafen von Hessen von Reichsrechtswegen zugefallen sind. Zur Erläuterung des fünften Artikels des Westphälischen Friedens; Offenbach a. M. 1783, S. 6f.[6] Der Tübinger Professor für Staats- und Lehnrecht, Johann Christian Majer, stellte zur Aktualität dieses Konfliktes fest: „Ein ganzer Mönchs-Orden ist in unsern Tagen schon aufgehoben worden (1773: der Jesuitenorden, R.S.). Die Aufhebung einzelner Klöster wird bey den Herrn Katholischen und deren Kirche immer frequenter. Die Rechtsfrage über deren auswärtige Renten kann im Verhältnisse zwischen Katholiken und Katholiken, oder einerley Glaubensgenossen sowohl, als zwischen Katholiken und Protestanten entstehen“. Johann Christian Majer, Erläuterungen des Westfälischen Friedens über geistliche Mediat-Stifter, Güter, deren in- und ausländische Renten... Tübingen 1785, S. IXf.[7] Anonym, Rechtliche Staatsbetrachtungen...a.a.O, S. 143.[8] Johann Christoph Koch. Kurze Revision der rechtlichen Staatsbetrachtungen über die Frage: Ob die in dem fürstlich hessischen Gebiete gelegenen Güter und Einkünfte der von dem Churfürsten zu Maynz im Jahre 1781 aufgehobenen drey Klöster dem Churfürsten zu Maynz oder den Landgrafen von Reichsrechtswegen zugefallen sind. Frankfurt a. M./Leipzig 1783.[9] Andreas Josef Schnauberts Widerlegung der ohnlängst in Offenbach herausgekommenen rechtlichen Staatsbetrachtungen über die Frage: Ob die in dem Fürstlich Hessischen Gebiete gelegenen Güter und Einkünfte der von dem Kurfürsten zu Mainz im verflossenen Jahre 1781. aufgehobenen drey Klöster dem Kurfürsten von Mainz oder den Landgrafen von Hessen von Reichtsrechtswegen zugefallen sind; Gießen 1783.[10] zit. nach: Arno Buschmann, Kaiser und Reich. Verfassungsgeschichte des HeiligenRömischen Reiches Deutscher Nation vom Beginn des 12. Jahrhunderts bis zum Jahre 1806 in Dokumenten. Teil II: Vom Westfälischen Frieden 1648 bis zum Ende des Reiches im Jahre 1806. 2. erg. Auflage Baden-Baden 1994, S. 15-106..[11] Johann August Schlettwein, Wichtige Beyträge zu der Gerechtigkeit in Absicht auf die Klöster und auf ihre in- und ausländischen Güter und Gefälle; Giessen 1785, S. 86.[12] Johann Niklas Friedrich Brauer, Abhandlung von den Normen zu Entscheidung der Strittigkeiten zwischen verschiedenen Religionsverwandten und deren Folgen auf die einer stehenden oder eingehenden Kirchenstiftung zugehörigen in andern Territorien gelegenen Renten und Gefälle – zu Erläuterung des 1ten, sodann 45sten bis 47sten §phen im Vten Artikel des Westphälischen Friedens, Offenbach am Main, 1784, S. 56.[13] Johann Richard von Roth, Vertheidigung der Rechtlichen Staatsbetrachtungen... a.a.O, S. 249.[14] ebd. S. 69.[15] so rückblickend unser Mainzer Rechtsprofessor, der sich inzwischen den Franzosen nach Aschaffenburg entzogen hatte und dort zum Rat des dortigen Oberappellationsgerichts avanciert war. Siehe: Johann Richard von Roth, Abhandlungen aus dem deutschen Staats- und Völkerrechte verschiedener praktischer Gegenstände und wirklicher Fälle...; Bamberg und Würzburg, 1804, S. 109f.[16] Stiftung Mainzer Universitätsfond (Hg.), S. 16.